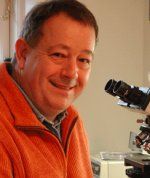Wärmeschutz im historischen Gebäude
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden
Wärmeschutz im historischen Gebäude
Die nachträgliche Anbringung einer Horizontalsperre erscheint problematisch (gesamtes Gebäude muss in mindestens einer Steinlage aufgetrennt und wieder vermauert werden, Gefahr von Setzungserscheinungen) und sollte deshalb unterbleiben.
Eine zusätzliche Wärmedämmung ist erforderlich, um erträgliche raumklimatische Verhältnisse zu schaffen.
Denkbare Varianten:
1. Innen Sanier/Dämmputz (zur Feuchtigkeitsaufnahme).
2. Innendämmung mit Schaumglas, direkt auf Außenwände geklebt.
3. Zusätzliche Innenschale, z.B. aus Porenbeton, mit Luftraum zum Bestands-Mauerwerk. Luftraum von außen belüftet.
4. Innendämmung mit Kalziumsilikat-Platten, direkt auf Außenwände geklebt. Unklar ist mir dabei, ob und wie ein Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Mauerwerk realisiert werden kann/muss.
Ortsbesichtigungen mit verschiedenen Fachleuten haben Vorschläge zu den Varianten 1 bis 3 ergeben. Was davon nun vorzuziehen ist, weiß eigentlich keiner zu sagen. Der Denkmalschutz empfiehlt die Variante 1, weil ihm Wärmedämmung egal ist und er nur an die Erhaltung der historischen Substanz denkt. Mir wäre aber eine Verbesserung der Wärmedämmung sehr wichtig.
Für Expertenmeinungen über das Für und Wider der geschilderten Varianten (oder bessere Vorschläge) wäre ich sehr dankbar.
-
Problematisch
Normalerweise rate ich zu der Variante mit Schaumglas, aber! Wenn es tatsächlich aufsteigende Feuchte ist, verschlimmern Sie das Problem noch. Denn dann fehlt der Wand die Wärme und das Wasser wieder verdunsten zu können.
Man sollte also zuerst - geht nur vor Ort - das Feuchteproblem lösen, dann das Dämmproblem.
Alternativen wären zum Beispiel auch Wandheizungen möglich. Aber auch das kann "im Auge" gehen, wenn das Mauerwerk dafür nicht geeignet ist. -
Das ging ja fix
Danke für die Antwort. Es IST aufsteigende Feuchte, definitiv! Was also tun? -
Fix?
Ich musste gerade mal kurz neues Netzteil einbauen. War eigentlich schon überfällig
Tja, aber jetzt von hier aus beurteilen ist schwer. Manchmal reicht ja eine senkrechte Sperre, die bis runter zum Fundament gezogen wird. Man müsste schon genau den Weg des Wasser kennen. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten der Sperrung, aber funktionieren tun nur wenige, und die nur bei speziellen Materialien. Vielleicht kann man Ihnen ja beiweiterhelfen?Oder ein Spezialist vor Ort.
-
Na, funktioniert ja wieder,
das Netzteil, meine ich. Aber mein Problem ist damit noch nicht gelöst ...
Gehen sie bitte (ich weiß, Experten lieben das nicht, weil sie erst das "eigentliche" Problem beseitigen wollen) davon aus, dass IMMER aufsteigende Feuchtigkeit in diesem Gebäude sein wird, dass ferner durch geeignete Maßnahmen die Menge dieser Feuchtigkeit zu verringern ist. Aber es bleibt eben bei einer signifikanten Mauerwerksfeuchte, insbesondere im unteren Bereich der Wand.
Wir haben es also nicht mit einer idealen Situation zu tun, sondern wir suchen einen realen Kompromiss. Was also wäre unter diesen Umständen ein empfehlenswerter Wandaufbau? -
Unter Vorbehalt
Die mit dem Schaumglas innen. Sie können zum Ausgleich noch Mineralwolle zwischen Schaumglas und Mauerwerk verwenden. Dennoch, die Feuchte muss da weg. -
Danke, und noch eine Ergänzung
So ein Gebäude hat eigentlich kein richtiges Fundament. Irgendwo im Boden beginnt das Mauerwerk. Der Boden ist ein feuchter Schwamm, durch den das Mauerwerk im Laufe der Jahrhunderte langsam absinkt. Das führt dazu, dass das ganze Gebäude in sich verformt ist, gewissermaßen selbst einen Hügel darstellt, mit der Mitte des Fußbodens in Gebäudemitte als höchstem Punkt, und von dort aus einem Absinken aller Gebäudeteile um vielleicht 1 bis 3 cm pro m Entfernung vom Mittelpunkt innerhalb von 100 bis 200 Jahren. Das geht also langsam, führt zu einer allmählichen Verformung des gesamten Gebäudes (Mauerziegel in Lehm und Kalkmörtel, also elastisch) und ist beherrschbar.
Zusammengebrochen sind diese Gebäude dort, wo man Dränagemaßnahmen ergriffen hat. Ergebnis: extreme Verformung bis zum Einsturz innerhalb weniger Jahre.
Mir erscheint es daher als einzige Chance zum dauerhaften Erhalt des Gebäudes, von folgendem Grundkonzept auszugehen:
a. Verminderung von direktem Wasserzufluss zum Wandbereich durch Verbesserung der Ableitung von Niederschlagswasser.
b. Ansonsten alles belassen wie es ist, aber innen was ordentliches zur Wärmedämmung tun. Aber eben, WAS? Es muss davon ausgegangen werden, dass der untere Wandbereich feucht ist und bleibt. Das ist einfach nicht zu vermeiden. -
Wie gesagt
Die Lösung mit dem Schaumglas. Schön Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) verkleben, und den Putz oder Gipskarton drauf. Gegen die feuchte könnte man Zementgebundene Dichtschlämme ggf. in den Boden Injizieren. -
historisches Gebäude aus Ziegelsichtmauerwerk
Lieber Dieter Reinhardt, eine nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre erscheint mir viel weniger problematisch und sehr sinnvoll. Der Vorschlag ein Austausch im Mauerwerk zu machen, erscheint mit hier auch sinnvoll. Das geht bei historischen Mauerwerksbauten sehr gut zu machen. Setzungen haben Sie nicht zu befürchten. Der Gewinn einer trockenen Bausubstanz überweigt alles andere an Sanierungskrampf und ist überdies immer und auch zuerst das wirtschaftlichste. Trockene Bausubstanz spart am meisten Energie und bringt zudem die größte Lebensfreude durch Behaglichkeit. Die erste Wärmedämmung (durch ein trockenes Mauerwerk) wäre also schon geschafft. Zu den Varianten 1. : Ein mineralischer Dämmputz ist meistens unproblematisch. Ein Sanierputz hat hier eigentlich nichts zu suchen, es sei denn Sie wollen die Feuchte einsperren und unter den Tisch kehren (So macht man eine Schnellschusssanierung beim Hausverkauf oder bei renitenten Mietern, damit Sie endlich still halten).2. Eine Innendämmung mit (stinkendem megasuperteuerem) Schaumglas, innen (mit Baukleber) direkt auf Außenwände geklebt, halte ich (aus pratischer Erfahrung mit Folgefeuchteschäden) für sehr bedenklich.
3. Eine zusätzliche Innenschale, z.B. aus (aufgeschäumten Betonmörtel) Porenbeton, mit Luftraum zum Bestands-Mauerwerk, Luftraum von außen belüftet halte ich bautechnisch und wirtschaftlich für einen historischen Mauerwerksbau für unsinnig.
4. Eine Innendämmung mit Kalziumsilikat-Platten, direkt auf Außenwände geklebt wäre eine (mäßige) Alternative zum Dämmputz, wenn Sie z.B. das Mauerwerk weiterhin feucht belassen. Es ist dann aber an stetiges ein Trockenheizen zu denken. Meine Empfehlung: 1. Trockenes Mauerwerk, entweder durch Einbau einer Pappe (500er besandet) oder Aufsägen und Einlegen einer Dichtung, begleitend behutsame Instandsetzung der Verfugung, Dachüberstände, Dachentwässerung etc., Spritzwasserschutz durch Kiesbett und Rückschneiden der Pflanzen, Sockel umlüftet und besonnt lassen weitläufig eine Flächenentwässerung (Bodenverbesserung durch Flächendrainage, da sind die Bauern Spezialisten) vom Haus weg führen. 2. Innenputz/Putzträger auf den Außenwänden aus z.B. Kalkgipsputz mit eingelegtem Heizrohrsystem als Wandstrahlungsheizung in Verbindung mit einer Brennwerttechnik. Das wäre meine Lösung unter dem Vorbehalt und der nicht unüblichen Einschränkung der Nichtortskenntnis ihres Einzelfalls. Viele Grüße, Hans-Joachim Rüpke
-
Fast-Zustimmung
Ich könnte ja fast vollständig zustimmen, bis auf Bodenmechanische Bedenken. Denn wenn Wasser dauerhaft abgeleitet wird, ändert sich - vereinfacht ausgedrückt - die Bodenkonsistenz. Das könnte denn doch zu Setzungen führen.
Natürlich ist eine nachträgliche Horizontalsperre nur Abschnittsweise und schwierig durchzuführen. Wird wahrscheinlich noch teurer als Schaumglas. Das stinkt übrigens nur beim Schneiden, danach nicht mehr.
Wandheizung ist ja nicht schlecht, aber die braucht viel (Verdunstungs-) Energie, um die Mauer zu trocknen. Zu trocken darf die ja auch nicht werden.
Wie Sie sehen, ist das eben ohne Ortsbesichtigung eine "Eiertanz". Deswegen sehe ich das hier auch nicht als Widerspruch zu Herrn Rüpke, sondern als Bedenken wegen fehlender Ortskenntnis. -
Dankeschön und eine Gegenfrage
Was spricht "bautechnisch und wirtschaftlich" gegen die zusätzliche Innenschale? Nach überschlägiger Kalkulation gehe ich davon aus, dass diese Lösung teuer ist als "nur Schaumglas", aber kostengünstiger als "Schaumglas und Horizontalsperre". Nachteilig ist die erheblich vergrößerte Wanddicke, wodurch die Fenster allmählich Schießscharten-Charakter annehmen. Aber wenn (WENN!?!) es bauphysikalisch die beste Lösung wäre, dann wäre dies in Kauf zu nehmen. Einen bautechnischen Nachteil vermag ich nicht zu erkennen. Meines Wissens wird dieses Sanierungskonzept oft bei Fachwerkhäusern verwendet, indem gewissermaßen in das vorhandene Fachwerkhaus ein komplettes "Innengebäude" gesetzt wird. Vielleicht können Sie ja erläutern, welche Nachteile Sie dabei sehen. -
Aufsteigende Feuchtigkeit?
Warum ist man sich immer so sicher, dass es aufsteigende Feuchtigkeit ist? Interessante Äußerungen kann man bei HP:nachlesen. Lassen Sie doch die Feuchtigkeit zerstörungsfrei entfernen zum Beispiel durch Mikrowellentrocknung. Dann stimmt der Dämmwert wieder und Sie haben keine Probleme mehr. Das Verfahren kann man auch aktive Temperierung nennen.
-
zweites Gehäuse, Innenschale
ja lieber Dieter Reinhardt, stimmt. Zuerst ein Hinweis auf das hohe neue Gewicht. Ich dachte Sie hätten schon Probleme mit den Lasteintragungen in den wabbeligen Untergrund. Sonst meine ich, grundsätzlich sind Innendämmungen wegen der hochdämmenden Materialien die schlechteste Lösung, die Kerndämmung die zweitschlechteste, die Außendämmung die effektiveste. Grob gesagt. Funktionieren kann jedoch auch eine schwache Innendämmung, wie vorher beschrieben, sodass zeitweise Feuchte auch nach innen abtransportiert werden kann. Die Lösung Haus im Haus bei einem Fachwerkhaus, die Sie da beschreiben ist ja der Krampf! Weil man in einer Sichtfachwerkkonstruktion nicht die heutigen Regelwerkansprüche bedienen kann, wird einfach ein Haus im Haus gebaut. Das Fachwerk davor können Sie nun nur noch als optischen Schnickschnack bezeichnen, oder noch besser, es wäre nur konsequent, es gleich ganz weglassen. Aber irgendwas mystisches hat eben unsere historische Baukultur, die Sie sich mit einem Neubau nicht kaufen können, Sie sind ein Stück Kulturgeschichte. Bauwerke kann man also unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten umbauen oder verändern. Man muss also zuerst entscheiden, was ist mir denn wichtig? Mir lag es also daran, ihr Bauwerk unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass es in der bestehenden (historischen) (Schwach-) Konstruktion dem Zweck nach funktionieren kann und soll. Ganz banal gesagt, man kann sich auch in einem Zelt wohlfühlen, wenn alles andere, wenn z.B. die Umgebung und das Wetter passt. Nun ist das im hohen Norden so eine Sache mit dem Wetter. Aber irgendwie müssen doch die Häuser vor 100 Jahren auch nach einem überlieferten bewährten Prinzip gebaut worden sein, den Menschen darin eine Obhut zugeben. Es hat sich in den Jahren aber viel verändert, keine Ofenheizung (gleichäßig verteilte Strahlungswärme) mehr, neue dichte Fenster, neue dichte Bodenbeläge, neue Wandbekleidungen und vor allen Dingen neue teuflische Farbbeschichtungen. Und außen wurde vielleicht vieles geändert oder ist zugewachsen. Dann die Frage der Bauunterhaltung? Wie Lage war was am durchplattern? Da kann ein Haus natürlich seinen Charakter verlieren und als völlige Schwachkonstruktion erscheinen. Natürlich müssen Sie sich selbst entscheiden, Sie müssen es ja bezahlen und darin wohnen. Insofern haben Sie Recht, wenn Sie erst einmal für sich kalkulieren und die Dinge von allen Seiten betrachten. Das ist eben ja auch der Sinn und Nutzen für uns beide bei solcher Unterhaltung, wie wir sie hier führen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Viele Grüße -
Warum man sich sicher ist?
Weil man es mit mehreren baupraktisch erfahrenen Leuten besichtigt und festgestellt hat, vom Bauunternehmer (mit langer Erfahrung in der Altbausanierung) über Mitarbeiter des Denkmalschutzes bis hin zum Bauherrn (mir), der sich da durchaus ein Urteil zutraut. Es ist angesichts der geschilderten Boden- und Gründungsverhältnisse auch zweifelsfrei.
Nur, zum Sanierungskonzept gab es keine wirkliche Entscheidung. Dabei hat aber zunächst die Frage der Wärmedämmung nicht im Vordergrund gestanden, sondern die der bautechnischen Sanierung. Und es herrschte offenbare Entschlusslosigkeit angesichts der Frage, ob es besser ist, eine nachträgliche Horizontalsperre einzubringen oder ob man das Mauerwerk unangetastet lassen soll.
Inzwischen habe ich gerechnet (am Energieverbrauch des Hauses), und angesichts der jüngsten Energiekostenentwicklung bin ich zu dem Schluss gelangt, dass die Verbesserung der Wärmedämmung ein zentrales Problem ist. Deshalb Stelle ich die Frage hier, mit dem Wunsch nach möglichst vielen fundierten Vorschlägen. Mit diesem Hintergrund möchte ich dann einen weiteren Termin (mit Fachleuten, selbstverständlich) vor Ort machen und danach eine Entscheidung über das Sanierungskonzept treffen.
NUR eine Mauerwerkstrockenlegung reicht sicher nicht. Wichtig ist mir die Wärmeisolierung, und innen im Haus soll es natürlich auch trocken sein.
Also, für hilfreiche Ratschläge über das Für und Wider der geschilderten (oder weiterer) Varianten bin ich weiterhin sehr dankbar.
Wichtig bei allem ist, dass es bezahlbar sein muss. Die Luxus-Version, das Gebäude mit einer wasserdichten Betonschale zu unterfangen, oder die Wände permanent trocken zu heizen, mag für ein staatlich gefördertes Museum gehen. Ich muss alles selbst bezahlen, meine finanziellen Mittel sind (wie bei nahezu jedem privaten Bauherrn) begrenzt, und meine eigene Arbeitskraft zur tatkräftigen Selbsthilfe hat auch natürliche Grenzen. Deshalb die Bitte um Diskussion und Mithilfe, um schließlich eine kostengünstige UND dauerhafte Lösung zu finden. -
Folgen Sie einfach Herrn Rüpke
Der hat das schlüssigste Komzept bei Ihren Voraussetzungen. Schaumglas ist in der Tat sehr teuer, aber dafür auch resistent gegen Schimmelbefall, deshalb mein Vorschlag.
Und bitte nicht unter den Tisch fallen lassen: das Trocknen UND Trockenhalten verbessert den Dämmwert schon erheblich. -
aufsteigende Feuchte im Norden, wir stellen die Mikrowelle auf die Probe!
Lieber Steier aus Bad Suderode, da haben Sie schon Recht, solche Frage stellt sich auch mir sehr oft - aber hier? Da scheint mir doch die Sau aus dem Stall zu laufen. Nur weil es so sein kann, muss es ja hier nicht auch so sein. Und auch wenn es ein Herr Fischer in allgemeinem Zusammenhang völlig sinnvoll erläutert, ist das noch kein Freibrief sich alle Leute microwellengerecht hinzubiegen. Ich finde es aber gut, Sie stellten Ihre Trockungsmethode einmal hier vor. Das wäre einmal eine konstruktive und für alle lehrreiche Methode, die dann auch eine angenehme Werbung darstellte. Was leistet denn so ein Microwellenverfahren und wo kann man es einsetzen, welche Taten kann es nicht versprechen? Zum Beispiel am hiesigen Fall! Also Dieter Reinhardt, geben Sie doch mal die technischen Daten, Wandstärke, Wandhöhe, Leitungsverläufe, etc. ... das könnte ganz konstruktiv interessant werden! Viele Grüße -
Ein Wort an Herrn Rüpke
Da haben sich nun unsere Beiträge überholt. Meine Erläuterung, warum man sich sicher ist, dass es aufsteigende Feuchte ist, galt natürlich Ihrem Vorredner
Nochmal zur Frage einer Innenschale:
1. Von außen ist das Haus wunderschön (finde nicht nur ich), deshalb kommt eine Außendämmung nicht in Frage. Ca. 50 % dieser Häuser haben eine solch schlechte Substanz im Außenmauerwerk, sodass dieses überputzt und gestrichen ist. Meines ist noch Original-Ziegelmauerwerk, und deshalb soll dies auch so bleiben.
2. Innen macht es eigentlich (bis auf den Schießscharten-Effekt) keinen Unterschied, ob noch eine Hülle drinsteht oder nicht. Ich habe ja kein Sichtfachwerk. Historisch waren die Wände innen verputzt.
3. Der Denkmalschutz hat aus prinzipiellen Erwägungen Vorbehalte gegen Porenbeton. Der Denkmalschutz würde Ziegelmaterial wie Poroton o.ä. bevorzugen. Das haben wir auch an einer Wand getan, die komplett neu errichtet werden musste (armiertes Betonfundament, Horizontalsperre, zweischaliges Mauerwerk, außen alte Original-Ziegel, fachgerecht vermauert, innen Poroton). Trotzdem ist die Wärmedämmung dieser Wand eher schlecht.
4. Bei den noch erhaltenswerten Wänden möchte ich keinesfalls ein dickes, schweres Poroton-Mauerwerk als zusätzliche Schale. Wenn, dann geht nur Porenbeton. Vom Gewicht her (da stimme ich völlig mit Ihnen überein) wäre die direkte Befestigung einer Innendämmung am vorhandenen Mauerwerk vorzuziehen. Bloß, da haben wir das Problem, dass dieses Mauerwerk eben leider feucht ist. -
Ach ja,
ich habe' schon mal so eine Mikrowellenfirma, die hier im Forum Ihre Wunderwaffen anpreist, um den Nachweis von Referenzobjekten in Norddeutschland gebeten. War aber nichts. Wie wollen Sie auch mit ein paar Milliwatt die Feuchtigkeit im Norden vertreiben? -
Feuchte, Wer definiert einmal diesen Begriff. Ab wann ist ein Baustoff gefährdet?
Wer diesen Beitrag weiter verfolgt, sollte wenigstens diese Kurzanleitung kennen. Ansonsten bin ich sehr erfreut über die Qualität der Beiträge. Ein Laie und auch so mancher Fachmann kann hierbei etwas lernen. Alleddings sind auch Empfehlungen dabei bei denen die Kosten aus dem "Ruder" laufen ... "Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein :- Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls
unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als warme Luft) ,
- Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
- Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen. Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten "Richtwerte"
Vergleichswert Luft = 1
Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5
Vollziegelmauerwerk 1700 1 - 2,5 1 - 3
Außenputz (KZM) 1800 4 - 14 4,4
Innenputz (KZM) 1800 1 - 10 4
Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6- ) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
- *) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt
(Öffnen Die die Homepage des Ziegelverbandes, oder Senden Sie mir Ihre Adresse dann erhalten Sie die Tabelle)
Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronenmessung usw.
Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10 - 20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Edmund Bromm
Literaturhinweise:
Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fas-sadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995. -
Hallo Herr Bromm!
Die Definition von Feuchte und die Definierung eines Grenzwertes hat mir gestern bei der Beantwortung der Frage nach dem Verputzen auf feuchtes Ziegelmauerwerk ebenfalls einiges Kopfzerbrechen bereitet. Weder in den Unterlagen der ÖAP noch im Ziegellexikon habe ich einen greifbaren Anhaltspunkt, einen Wert gefunden, nach dem man entscheiden kann, ob ein Ziegelmauerwerk für einen Gipsputz ausreichend trocken ist! Hier steht der putze auf der Baustelle im Regen und hat dann "nach Gefühl", nach optischem Erscheinungsbild oder Krücken wie den billigen, elektrischen Feuchtemessgeräten zu entscheiden, riskier ich es oder riskier ich es nicht, und wenn ich es nicht riskier, wie kann ich das meinem AG begreiflich machen, wenn ich schon keine DINAbk. herbeizerren kann, und der nur glaubt, ich fang nicht an, weil ich vielleicht Kapazitätsprobleme habe oder irgendwo zusätzlich Geld rausschinden will. Begrüssenswert, dass Sie mich auch nochmal auf die WTAAbk. hinweisen - ich habe per Homepageformular vor vielen Wochen einen Schwung Merkblätter bestellt - angekommen ist nichts ... Schade, dass Sie in Kassel nicht dabeisind. -
Norddeutsche Backsteinbaukunst
Lieber Dieter Reinhardt, das ist gut, dass der Denkmalschutz hat aus prinzipiellen Erwägungen Vorbehalte gegen Porenbeton hat. Porenbeton ist nicht kapillar und daher kommt einmal darin eingelagerte "Feuchte" (z.B. durch Kondensation im Bauteil) (aber auch schon die Baufeuchte) nicht so schnell heraus. Bei Problemwandaufbauten ist es daher nicht ratsam Poroton zunehmen, allerdings ebenso schlecht ist man bei hochgebrannten Porenziegeln 1,4/1,8 bedient. Einmal durch Kondensation eingebrachte "Feuchte" wieder herausbringen ist schwer. Aber das ist ein Spezialthema. Mir liegt immer noch am Herzen Ihnen eine Wandflächenheizung (Strahlungsheizung) näher zu bringen. Es ist vom Verständnis nicht leicht zu begreifen, aber die funktioniert (mit sehr niedriger Vorlauftemperatur) - ohne dass Sie nach außen wegheizen - keine Angst, das rechnet sich besser als manch andere vage und kontroverse Dämmlösung. Leider bin ich da nicht der Fachmann. Aber ich kann Ihnen schon sagen, praktisch ist die sehr einfach und preiswert zu installieren und der Erfolg ist gerade bei Sanierungen (mit zu feuchten Wänden) überraschend und überzeugend. Da Sie vermutlich schon eine Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur haben, muss man da mal einhaken. Vielleicht lassen Sie sich da von einem Fachmann hierfür beraten. Der Prof. Claus Meier hat mir mal einen Architekenkollegen (ich glaube aus Berlin) vorgestellt, aber ich finde seinen Namen und sein Skript nicht mehr wieder. Vielleicht kennt ja Herr Bromm den Namen oder einen Fachmann hier im Norden. Jedenfalls sehe ich da eine Lösung für Ihre Problem auch mit der "Feuchte", die hier sicherlich weit über der normalen Ausgleichsfeuchte für Vollziegelsteine 1,8/2,0 liegt und somit tatsäch primär Ursache des energetische Problems ist. Ansonsten können Sie sich ja nun zurücklehnen und sich in fachübergreifender Beratung sonnen. Nochmals viele Grüße auch nach Bavaria! -
Da ist der richtige Weg!
Wenn Sie eine Wandheizung oder Tapetenheizung in die Wand einbauen treiben Sie die Feuchtigkeit immer zum kalten hin und das ist nach außen. An einer warmen Wand wird sich keine Kondensfeuchte niederschlagen. Die trockene Wand hat einen hervorragenden Dämmwert und die Dämmung- und Sperrschichten können Sie vergessen. Das spart richtig Geld und bringt Wohlbefinden in Ihr Haus. Wenn noch ein oder zwei Ecken feucht bleiben, weil dort keine Wandheizung installiert werden konnte, können wir ja mal unsere Methode vorführen. Die völlig überspitzten Ausführungen über Feuchtigkeitswerte in der Wand dienen meist als Alibi für unbedingt einzubringende Sperrschichten. Wohlfühlen muss man sich in seinen 4 Wänden. Nur das zählt. -
Nicht schon wieder Vermutungen!
Wir kennen das Mauerwerk nicht. Aufsteigende Feuchte in einem - vereinfacht ausgedrückt - stark kapillaren Baustoff kriegt die Wandheizung auch nicht weg. Wie schon oben gesagt, bracuht man denn Energie für die Verdunstung.
Wieso hat die Wand einen hervorragenden Dämmwert? Wir wissen nicht, woraus die ist, und wie dick.
Also bitte erst Fakten abwarten! -
Also. rechnen kann ich schon
Wie Herr Beisse richtig sagt: Vermutungen nützen nichts. Die vorhandene Wand hat einen miserablen Dämmwert (32 cm Vollziegel-Mauerwerk, feucht, Innenputz, sonst nichts), da gibt's nichts dran zu deuten. Es nützt nichts, sich historische Bauten ideal reden zu wollen. Als das Haus gebaut wurde, waren die Wohnanforderungen ganz anders als heute. Ein Wohnklima nach heutigen Vorstellungen erreicht man auch nur mit einem k-Wert des Wandaufbaus nach heutigen Normen. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. -
Oh Oh
das lassen Sie aber man nicht den Herrn Konrad Fischer hören ... Naja, er bezahlt ja auch nicht Ihre Heizkosten Wär doch eine nette Wette, oder nicht? Ich gucke auch ganz unschuldig ...
Wär doch eine nette Wette, oder nicht? Ich gucke auch ganz unschuldig ...
-
"Aufsteigende Feuchte"
Um es mit den (wie immer blumigen Worten von Herrn Fischer zu
sagen:
Worten von Herrn Fischer zu
sagen:
"Eine der für die Baubranche wunderbarsten Irrtümer der Bauherrn, Laien und schwachverständigen Experten ist die sogenannte "Aufsteigende" Feuchte. Fast nicht bringt dolleren Reibach! Anstelle zielgerichteter Bauwerksreparatur werden Maßnahmen herbeigeführt, die vom analysegeilen Baustofflaboranten über die Planerlusche bis zum blindesten Bauhandwerker die Taschen füllen. Und dem Bauherrn als Expertentum vorgespiegelt. "
Originalseite siehe erster weiterführender Link unten (wie auch schon in Herrn Steiers Beitrag angegeben); schauen sie sich das unbedingt an, wenn Sie es noch nicht getan haben.
Ganz kurze Zusammenfassung: Feuchtigkeit dringt immer immer aus den grobporigen in die feinporigen Schichten, nie umgekehrt (klingt physikalisch plausibel). Entsprechend ist laut Fraunhofer die Steighöhe bei Ziegelmauerwerk ca. 20 cm. In Wirklichkeit kommt die sogenannte "Aufsteigende Feuchte" gerade bei historischen Bauten meist aus ganz anderen Quellen als dem Boden: 1) Salzbelastung im Mauerwerk (hygroskopische Wasseraufnahme); 2) Kondensation; 3) Beregnung. Dagen hilft die Horizontalsperre natürlich nicht.
(Natürlich kann durch Salzeinlagerung auch das gesamte Mauerwerk feinporig werden ...).
Was ich damit nur sagen will: Vorsicht! Sorgfältig klären: Wie feucht ist das Mauerwerk wirklich? Welche Auswirkungen (Energieverbrauch, Innenwandschäden) hat diese Feuchte wirklich?
Wenn Sie noch ein paar zusätzliche Details nachliefern, könnte man diesbezüglich einen etwas besseren Eindruck der momentanen Lage gewinnen: Wohnfläche, Heizölbedarf pro Quadratmeter, Innenwandzustand (Schimmel, Feuchte, Putzschäden, etc. ; schon immer so, oder etwa erst seit z.B. neue Fenster eingebaut).
Als Physiker macht es Ihnen vielleicht auch Spaß, selbst loszulegen, und z.B. die lokalen Wandoberflächen- und Lufttemperaturen (Wandoberflächentemperaturen, Lufttemperaturen) zu dokumentieren; nutzen Sie die letzten kalten Tage! Daraus lassen sich leicht grobe Schätzungen der lokalen k-Werte ableiten:
k-Wert = (Innentemperatur - Wandtemperatur) / (0.13 * (Innentemperatur- Außentemperatur) )
Und diese können wieder Hinweise auf den Einfluss der Feuchte geben: wie verschieden sind die Werte 1 m überm Boden und unter der Decke?
Digitalmultimeter mit Temperaturmessung gibt's bei Conrad (VC 333,- 20.. 1000 Grad, DM 26.95, billiger wird's nicht, siehe zweiter
weiterführender Link unten). Pressen Sie die Spitze des Drahtfühlers mit einem Stück Styropor auf Wand, und warten Sie, bis sich die Temperatur eingependelt hat. Dann lokale Lufttemperatur.
Wenn sie von innen isolieren, wird das Ziegelmauerwerk notwendigerweise kälter, und damit eher noch feuchter. Insbesondere bei einer Innendämmung mit zeitgeistgemäß gutem K-Wert und hohem Wärmewiderstand (im elektrischen Analogon Spannung = Temperatur ist dann der Wärmestrom kleiner, aber ein Großteil der Spannung fällt an dem großen Wärmewiderstand der Innendämmung ab).
In diesem Sinn widersprechen sich die beiden Ziele trockenes Mauerwerk und niedriger k-Wert.
An Maßnahmen, die K-Wert reduzieren UND Mauern trocknen, fällt mir auch nur Strahlungsheizung (Wandheizung/Heizleistenheizung) ein.
Bezüglich Wandheizung: Da 32 cm ja nicht sonderlich dick ist, könnte ich mir vorstellen, dass eingeputzte Rohre doch zu viel Wärme nach außen abgeben. Vielleicht ließen sich diese Verluste durch ein gewisses Maß an Dämmung zwischen Rohren und Wand auf einen vernünftigen Wert einstellen; da müssten mal Experten mit praktischer Erfahrung damit ran.
Bezüglich Heizleistenheizung: Das wäre mein Favorit in der (mir allerdings nur teilweise bekannten) Situation. mäßig Temperierung und Trocknung der Wände, minimaler Decke-Boden-Temperaturgradient, minimale Luftbewegung. Ein solches Wohnklima dürfte eigentlich auch heutigen Vorstellungen entsprechen; oder gibt es noch weitere Eigenschaften, die Sie anstreben wollten?
Zur Frage "Welches Heizleistensystem? ": Herr Ostertag hat dazu eine Reihe von Links zusammengetragen, siehe(sorry, die weiterführenden Links waren erschöpft
 . Im Prinzip
könnte man wohl sogar die niedrigsten Konvektorheizkörper (30 cm?)
entlang der ganzen Außenwand ziehen. Durch die große Heizfläche käme
man dann ggf. mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen aus. Kompaktere
Heizleisten brauchen entsprechend höhere Vorlauftemperaturen.
. Im Prinzip
könnte man wohl sogar die niedrigsten Konvektorheizkörper (30 cm?)
entlang der ganzen Außenwand ziehen. Durch die große Heizfläche käme
man dann ggf. mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen aus. Kompaktere
Heizleisten brauchen entsprechend höhere Vorlauftemperaturen.
Und da Sie auch "Sanierputz" erwähnen: Lesen sie auch mal im dritten weiterführenden Link, was Herr Fischer dazu meint. Ganz kurz: schade statt zu nutzen; sei dazu teurer; besser sei einfacher Kalkputz, nötigenfalls in langen Intervallen erneuert (Opferputz).
Zur Wirtschaftlichkeit: Wenn Sie z.B. DM 45,000 in Schaumglas, Horizontaldämmung und ähnlich aufwendige Maßnahmen investieren, dann müssten Sie schon Heizöl für DM 3000 pro Jahr sparen, damit sich's gerade so rechnet. Und letztlich, wie sieht's aus mit Dämmung zum Boden und zum Dach? Vielleicht ließe sich da etwas verbessern mit (im Vergleich zur Innendämmung) besserem Kosten/Nutzen-Verhältnis und geringerem Bauschadenrisko?
Ich wünsche Ihnen noch viel Freude an Ihrem historischen Backsteinhaus mit eingebauter Solarnutzung! (Während eine strahlend weiße Wand 85 % der Sonnenenergie reflektiert, fängt eine dunkle Backsteinwand ja über die Hälfte der Sonnenenergie ein!
- http://www.konrad-fischer-info.de/2aufstfe.htm
- Web-Link[PAGEID]=39786&TK_EV[SHOWPAGE]=
- http://www.konrad-fischer-info.de/2sanipuz.htm
-
Bravo Herr Lange
Damit haben Sie mir wieder viel Tipparbeit erspart Sie haben Recht.
Sie haben Recht.
-
Dankeschön, ich muss jetzt mal nachdenken,
aber das mit der Solarnutzung vergessen Sie mal gleich wieder. Auf der Südseite des Hauses steht eine dichte Reihe von Linden, das ist so Tradition und gehört unbedingt dazu.
Dämmung zum Boden: zurzeit Hohlraum, darüber Dielenbretter, ohne Nut und Feder, holzwurmzerfressen. Da hilft nur eine Totalsanierung, also aufschütten, Magerbeton, PU-Schaumplatten usw., eigentlich wie Neubau, dann aber auch mit entsprechenden Dämmwerten.
Dach: Reetdach, bereits ordentlich saniert. Ich habe auch schon mal im Forum einige Male nach Erfahrungen und Dämmkonzepten dazu gesucht, ist nicht viel gekommen, ich glaube aber, dafür habe ich inzwischen ein brauchbares Konzept. Genaue Werte muss ich aber noch durchrechnen. Leider gibt es dazu wenig (und widersprüchliches) Tabellenmaterial.
Die Frage nach der momentanen Lage ("Heizölbedarf pro Quadratmeter") ist sehr akademisch. Wir können sie nur vom Bauzustand her angehen, nicht von Erfahrungswerten. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt und unbeheizt. Davor war es mit einer Mischung aus archaischer Ofenheizung und missglückter Elektro-Speicherheizung versehen. Die habe ich, ohne weitere Tests, herausgerissen, da die Elektroinstallation aus Sicherheitsgründen ohnehin stillgelegt war. Meine Begeisterung für Asbesteinblasvorrichtungen ist sowieso begrenzt.
Es hilft also nichts, dieses Objekt muss von den Grundlagen her angegangen werden. Verwertbare Erfahrungen, auf denen man aufbauen könnte, gibt es leider nicht. -
Ups!
Habe ich das überlesen? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es unbewohnt war ... Denn muss man die Feuchte wirklich neu beurteilen. -
Noch eine Anmerkung
Es gibt so ein generelles Ziel, an dem sich alle Überlegungen zur Wärmedämmung orientieren, und das heißt rechnerischer Heizwärmebedarf um 100 W/m².
Erstens, weil ein darüber liegender Heizwärmebedarf langfristig ökonomisch und ökologisch schwer verantwortbar ist. Natürlich muss die Sanierung außerdem jetzt auch bezahlbar sein, deshalb ja meine Fragen nach dem günstigsten Konzept.
Zweitens, weil die zu beheizende Fläche (wenn denn dieses Haus jemals voll ausgebaut sein wird, also, falls ich noch lange lebe, kurz vor meinem Tode ...) um 450 m² liegt und bei mehr als 50 kW Heizleistung verschärfte Anforderungen an den Heizraum auf mich zukommen, und das Heizöllager größer werden muss, und ich weiß einfach nicht, wo ich das alles unterbringen soll. In einem Nebengebäude z.B. , aber das kann ich mir finanziell nicht erlauben, und eine Baugenehmigung dafür bekomme ich sowieso nicht.
Drittens, weil es eine Wärmeschutzverordnung gibt, und deren Vorgaben muss ich bei einem Ausbau des Gebäudes zumindest näherungsweise einhalten.
Also, der Heizwärmebedarf muss sich etwa in dem Bereich bewegen, der heutzutage als "normal" (nicht: Niedrigenergiehaus) anzusehen ist. Ehrlich gesagt, anders ist die Nutzung historischer Gebäude auf Dauer auch schwer vertretbar. -
Habe gerechnet, jetzt weitere Fragen
Ich habe mal die besprochenen Varianten beispielhaft durchgerechnet, und jetzt versteh ich einiges nicht mehr, insbesondere zum Thema Tauwasseranfall. Ob die Experten Beisse, Rüpke u.a. mir hier bitte noch mit ein paar Erläuterungen helfen können?
1. Ist-Zustand (von innen nach außen)
1,5 cm Kalkputz (auch bei allen weiteren Varianten)
32 cm Vollziegel (1800 kg/m³, lambda=0,81 W/mK)
k-Wert 1,72, kein Tauwasseranfall (wo auch!?)
2. Innen zusätzlich 5 cm Schaumglas WLG40:
k-Wert 0,55, kein Tauwasseranfall (da diffusionsdicht), aber das erörterte Problem, dass Ablüften des Ziegelmauerwerks nach innen unmöglich.
3. Innen zusätzlich 6,5 cm Kalziumsilikatplatte WLG60:
k-Wert 0,60, 1,69 kg/m² Tauwasseranfall! Das verdunstet zwar wieder, ist aber nach DINAbk. 4108 unzulässig.
4. Zusätzliche Innenschale 11,5 cm Porenbeton PPW2 (lambda=0,11) mit 6 cm Luftschicht:
k-Wert 0,54, Tauwasseranfall (an der Innenseite der Außenschale) 0,65 kg/m², Verdunstung 0,90 kg/m².
Fazit:
Nach DIN ist Version 3 unzulässig (unabhängig von der Frage des feuchten Bestandsmauerwerks). Gleichzeitig hat diese Version aber das höchste Wasseraufnahmevermögen (Aufgrund des verwendeten Baustoffs)!
Version 2 ist zulässig und erzeugt kein Tauwasser, sperrt aber die Mauerfeuchtigkeit nach innen ab.
Version 4 führt zu etwas zusätzlichem Feuchtigkeitsanfall, ist aber zulässig und außerdem hinterlüftet.
Version 1 haben wir, die ist indiskutabel. Wie ist dies alles nun zu werten? -
Tja, eine Version fehlt
Nämlich die Wandheizung. Und die können Sie mit der Glaser-Methode nicht berechnen.
Ein Hinweis zur Beruhigung: nach innen diffundiert überhaupt nix. Der Diffusionsstrom geht immer vom warmen zum kalten. Innen trocknet durch Luftströmung und Wärme höchstens die Oberfläche. -
Das versteh' ich jetzt nicht
Natürlich spreche ich von der Diffusion der Raumfeuchtigkeit in die Wand, wovon denn sonst? Und meine Frage war, wie die Sperrwirkung der verschiedenen Wandaufbauten einerseits (gegen die vorhandene Mauerwerksfeuchtigkeit im Bestand) und die unterschiedlichen Diffusionsmengen (aus dem Innenraum, natürlich) und deren Anreicherung in den Baustoffen zu bewerten sind. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Aufbau mit Kalziumsilikatplatten nach DINAbk. unzulässig ist.
Grundvoraussetzung: die bauphysikalischen Effekte sind mir verständlich. Aber mir ist nicht immer verständlich, was dies für die Praxis bedeutet. 0,65 kg/m² oder 1,69 kg/m² sagt mir nichts, ist das schlimm oder belanglos für den Baustoff? Bitte etwas sorgfältiger lesen und etwas überlegter Antworten. Ich habe ein Problem, und das möchte ich lösen. Und für Ihre Diskussion und Mithilfe bin ich wirklich sehr dankbar. -
Ja klar, ist ja auch sehr komplex
Ich habe es gelesen, keine Bange. Allerdings ist das Thema Bauphysik ohnehin schon sehr komplex. Sie konzentrieren sich jetzt auf die anfallende Feuchte, können diese aber nicht interpretieren, klar. Das kann ich so ohne Weiteres auch nicht
Sollten Sie nach dem Glaser. Verfahren gerechnet haben, ist das schon mal an sich kritisch zu sehen. denn das Verfahren ist umstritten.
Feuchte sollte auf jeden Fall erstmal vermieden werden. Bedenken Sie, dass die Feuchte - theoretisch - in der Tauperiode anfällt (Winter) und in der Verdunstungsperiode (Sommer) erst wieder verdunstet. in der Zwischenzeit haben Pilze & Co. genügend Zeit, es sich gemütlich zu machen.
Theoretisch wäre also nur Version 2 möglich! Aber eben nur theoretisch, weil Sie nur einen Aspekt betrachten. Ausgehend von aufsteigender feuchte, wird die sich noch weiter ausdehnen, weil Sie mit dem Schaumglas die Wärme von innen wegnehmen, die wieder trocknet!
Also wieder zurück zum Anfang: zunächst muss die feuchte bekämpft werden, dann die Wärmeverluste. -
Tut mir leid,
wenn ich lästig werde, aber ich möchte dem Verständnis einer möglichen Lösung meines Problems näher kommen. Die Problemlösung wird teuer, und sie wird besonders teuer, wenn's nicht klappt. Daher also meine Hartnäckigkeit.
Gehen wir mal davon aus, dass etwas gegen die aufsteigende Feuchtigkeit geschieht, mehr oder weniger wirkungsvoll. Dann müssen wir trotzdem die Innenwand isolieren. Und da ist folgende Situation:
Version 2: Ideal, weil keine zusätzliche Feuchtigkeitsbelastung?
Version 3: Ideal, weil hohes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen, aber unzulässig?
Version 4: Ideal, weil vom Bestandsmauerwerk entkoppelt?
Version 5 (hatten wir noch nicht): Vielleicht ein besserer Vorschlag, irgendwie eine Sandwich-Konstruktion, oder noch eine Dampfbremse? Ich bin ja für alle Vorschläge dankbar.
Gehen wir ferner bitte davon aus, dass jedenfalls die Innenisolierung was taugt. Dann ist die Frage einer Heizleisten-Strahlungsheizung (oder auch nicht) für mich durchaus erwägenswert. Sie hat aber mit dem Problem der Wärme/Feuchtigkeitsisolierung nichts zu tun. Wir müssen von k=1,7 auf ungefähr k=0,5 bis 0,7 kommen. Da hilft kein Trockenheizen.
Gerechnet habe ich nach Glaser, was anderes kann meine Software auch nicht. Ob das Verfahren umstritten ist oder nicht, kann bis zu einem gewissen Grade egal sein. Es ist die Grundlage der aktuellen Normung, und es liefert sicher eine Richtlinie für die ablaufenden Prozesse (wenn auch nicht unbedingt einen exakten Wert). -
Nicht lästig! Sondern Interessant!
Ich würde mir das ja liebend gerne vor Ort anschauen. Aber egal. Eine Herausforderung ist es allemal. Lästig sicher nicht!
Angenommen, die Feuchte wird dauerhaft abgestellt, gibt es 3 mögliche Varianten, die letztendlich der Preis entscheidet:
Wandheizung mit passendem Putz
Schaumglas an der Wand mit Mineralfaser zum anpassen, Auf dem Schaumglas Putz
Das gleiche nochmal, mit Wandheizung
Abreißen der Hütte und nochmal neu anfangen Sorry, Spaß muss sein ...
Sorry, Spaß muss sein ...
Was ist eigentlich außen überhaupt möglich? Immer ruhig weiter, sehr interessantes Thema! -
Abreißen ist gar nicht so dumm,
aber zu teuer. Etwa ein Drittel der Wandlänge war abgängig (Westseite und Nordwestecke), das haben wir neu gemacht und eigentlich zu schlecht wärmegedämmt. War vor 1 1/2 Jahren, und damals habe ich über das Thema nicht richtig nachgedacht, sondern mich zu sehr nach dem Rat der "alten Hasen" gerichtet. Aber handwerklich ist es spitzenmäßg geworden, das tröstet über den schlechten k-Wert hinweg.
Falls sie mal demnächst einen Termin in der Nähe von Husum haben, können wir uns da gerne treffen ...
Außen ist (natürlich) nichts möglich, ist ja Backstein-Sichtmauerwerk. Innen ist (im fraglichen Gebäudeteil) alles möglich - wenn wir mit den Preisen auf dem Teppich bleiben. -
Husum?
Warum sagen Sie das nicht gleich? Da war ich doch erst letzte Woche wegen des Arbeitsamtes und den weggeflogenen Ziegeln. Tz Tz. Mal sehen, was draus wird ... -
Wär' sicher schön,
wenn das ginge. Bitte ein paar Tage vorher melden zur Terminvereinbarung. So, jetzt mach ich Schluss für heute. Schönen Abend noch! -
Zu allererst Flächendrainage
HKR hat es doch schon angeraten, wo wonst soll auch die Feuchtigkeit herkommen, wenn nicht von unten? -
Haben Sie ein Ausführungskonzept
für Flächendrainage in stark Klei-haltigem Marschboden? Auf einer Warft? Ohne Störung des Bodengefüges, ohne Gefahr für die Standsicherheit des Gebäudes? Ein Literaturverweis würde auch helfen.
Ernsthaft: Es ist alles nicht so einfach. Tatsächlich kommt die Feuchtigkeit von oben, das ist wohl richtig. Wichtiger dürfte es daher sein, den direkten Zustrom von Oberflächenwasser zu verringern. Schon das ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Jedenfalls muss man am Haus anpflastern, gleichzeitig erhöht dies aber die Belastung durch Spritzwasser (Reetdach, eine Dachrinne gibt es nicht, und der Dachüberstand ist nicht so gewaltig!). -
Ringdrainage tut es auch
es hat den selben Effekt und wenn es leichter durchzuführen ist, sollte dies das sicherste, effektivste, preiswerteste, nachhaltigste, ökonomischste und ökologischste Mittel der Wahl sein. Machen, schauen, und nach wenigen Monaten sehen Sie genau, wo die "ewige" Lösung ist. Viel Glück, fragen Sie ruhig die Nachbarn als Bauern und Fachleute zu Einzelheiten der Drainage, wie auch schon von HJR empfohlen (sorry, nicht KHR, mein falscher Fehler!). Habe mein Haus am Hang hier auf eine "Ringwarft" gestellt, alles ist sicher und trocken. -
Aber nicht ohne Bodengutachten
Die Idee ist ja gut, aber bei solchen Trockenlegungen habe ich gerade im Norden schon zu viel erlebt. Deshalb bitte Bodengutachten. -
Der Link
funktioniert nicht. Geben Sie den bitte noch mal genau an!?!
Ich will da gerne mal nachsehen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Lösung ist. Ich will schließlich nicht, dass mir das ganze Haus in den Graben von der Drainage rutscht. Sie müssen bedenken, dass diese Häuser SEHR flach gegründet sind, einfach Backstein-Mauerwerk in die Erde, kein Betonfundament - nicht mal ein Natursteinsockel!
Bei dem Teil, wo wir die komplette Wand saniert haben, haben wir natürlich ein Betonfundament genommen, mit Stahlkörben armiert, frostsicher gegründet, Horizontalsperre usw. usw. - das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Bestandsteil, mit seinem bauphysikalisch falschen, aber nun mal historisch vorhandenen Aufbau. -
Der Link
diesmal richtig -
Habe ich mich jetzt verlesen?
Der Link ist ja nett, aber hat er was mit Drainage zu tun? Oder habe ich etwas überlesen? Die Sache mit den groben Flusskieseln (bei uns heißt das Katzenköpfe) ist sicher richtig, die sollen zum Schluss der Sanierung als Regentropfen-aufbrechende Pflasterung ans Haus kommen und den Niederschlag etwas vom Haus wegleiten. Das habe ich nicht erfunden, das macht man so. Sonst sehe ich da aber keinen Bezug zum Thema. -
hmm, gute Frage
Ich habe den Link ungeprüft ergänzt ... Zusammenhang sehe ich aber auch nicht so richtig. -
bitte richtig lesen!
der "Link" sind natürlich und unmissverständlich die lokale Kenntnis und praktische Erfahrung der Nachbarschaft, auch MB hat es angedeutet mit seinem "Bodengutachten" wobei die Bauern möglicherweise genauere und zuverlässigere lokale Kenntnis (vielleicht sogar kostengunstiger!) besitzen als das Gutachten stellen kann. Niemand weiß besser als die Nachbarschaft, wo oder wie die beste Lösung zu einer Drainage zu finden ist. Die Anregung zur optischen Gestaltung mit Kieselsteinen erschien mir soweit als erkennbar, dass dies keine Arbeitsgrundlage zur Planung einer Drainage werden konnte. Insgesamt denke ich, hat man hier in bester Form für die Sanierung des Baus einen Königsweg aufgezeichnet. Ob die Drainage dann in einer oder mehreren Ebenen abgestuft wird, ist zweitrangig, der Sicherheit des Hauses droht mE von daher dann keine Gefahr mehr. Der Weg zur Vollendung ist mE jetzt also recht einfach. Ich wünsche viel Erfolg. -
Nachbarschaft?
Der nächste Hof ist über einen halben Kilometer entfernt und kurz vor dem Zusammenstürzen. Aber trotzdem bewirtschaftet, und wie, der Bauer hat 'nen tollen Lamborghini (-Traktor). Davon versteht der was, von Bauwerkserhaltung wohl eher nicht so viel. -
Bitte nochmal mitdenken
Jetzt habe ich nochmals eine Frage, insbesondere an Herrn Beisse, und natürlich an alle anderen, die sich dankenswerterweise an der Diskussion beteiligt haben.
Gedachter Wandaufbau von außen nach innen:
1. Bestandsmauerwerk, 32 cm Vollziegel-Mauerwerk
2. Innendämmung, 3 cm Schaumglas WLG 40
Davor Gipskarton-Innenschale auf 7,5 cm U-Profilträgern (an Boden/Decke befestigt), mit Dämmung und Dampfsperre, Schichtfolge also:3. Steinwolle, 6 cm WLG 40
4. Dampfsperre, Aluminiumfolie
5.1 bis 1,5 cm Luftraum
6. Gipskartonplatte 12,5 mm
Dieser Aufbau erreicht einen k-Wert von 0,31 bei, wie ich denke, mäßigen Kosten (teures Schaumglas nur in Mindeststärke), er ist leicht, änderungsfreundlich, kann Installationen aufnehmen und vermeidet den komplizierten Putzaufbau auf Schaumglas.
Das ganze entsprechend dem Diskussionsstand mit vorheriger Feuchtigkeits-Sanierung (Horizontalsperre). Die Schaumglas-Schicht direkt auf der Wand soll dazu dienen, eventuellen Feuchtigkeitsanfall aus dem Bestandsmauerwerk gegen den Innenraum abzusperren. Gibt es Kommentare dazu, was dafür oder dagegen spricht? -
Wo mir doch das Denken so schwer fällt ...
Hmm, hanz kapiert habe ich den Aufbau noch nicht. Ich versuche mal nachzuvollziehen und zwar von außen nach innen:
1. Bestandsmauerwerk
2. Schaumglas 40 mm
3. Mineralfaser
4. Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)
5. Innenbekleidung
Wenn so gemeint ist, ist es OK. -
Wärmespeicherfähigkeit
einer Wand - sehr sehr wichtig für ein angenehmes, ausgeglichenes Wohnklima - ist hierbei stark vernachlässigt, siehe auch Beiträge unter Neubau 851. -
So ist es
Schichtfolge stimmt so, nur Schaumglas lediglich 30 mm (weil billiger). Meine Frage nach Kommentaren zielte in zwei Richtungen:
1. Ich habe einen solchen Aufbau nirgendwo empfohlen gesehen, kann aber bauphysikalisch nichts fehlerhaftes erkennen. Allenfalls die Gefahr, dass durch defekte Dampfsperre bzw. unzureichende Verklebung des Schaumglases langfristig eine Feuchtigkeitsanreicherung in der Mineralwolle auftritt. Ist das ein reales Risiko, oder praktisch völlig ungefährlich?
2. Ich bin noch am kalkulieren/lassen. Gibt es zu der Annahme, dieser Aufbau sei besonders kostengünstig (deshalb habe ich ihn ja gewählt), Kommentare?
Und noch eine Zusatzfrage: womit sollte die Schaumglasdämmung am Bestandsmauerwerk befestigt werden - Bitumenkleber, mineralisch/kunstharzgebundener Klebemörtel oder vollmineralischer Klebemörtel? -
Stimmt, Herr Rothlach,
bloß - haben Sie eine bessere Idee? Das Ziel ist, beim nun mal gegebenen Bestandsmauerwerk einen k-Wert von ca. 0,5 zu erreichen.
Außerdem besteht die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes ja nicht nur aus der Außenwand. Die macht, grob geschätzt, und natürlich raumweise unterschiedlich, beim vorliegenden Objekt irgendwas zwischen 10 % und 50 % aus. Es dreht sich ja nicht darum, in dieser Bauweise einen Baracken-Neubau zu errichten. -
Keine Gefahr
Solange die Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Mineralfaser ist auch nicht besonders empfindlich gegen feuchte. Die Schaumglashersteller haben entsprechende Kleber im Angebot, nur die Bezeichnungen vergesse ich immer (PC51 oder so ähnlich) -
Ich lass' nicht locker!
Noch mal genauer gefragt: Foamglas bietet drei verschiedene Sorten Kleber an, auf Bitumen-Basis, mineralisch-kunstharzgebunden (das ist offenbar die Standardversion) und vollmineralisch. Wie sind denn die Erfahrungen, was ist für den vorliegenden Fall ("etwas" feuchtes Mauerwerk, da ein gewisses Maß von Durchfeuchtung durch Schlagregen und Betauung immer auftreten wird) empfehlenswert? -
Und noch eine Nachfrage an Herrn Rothlach
Ich habe mir die Mühe gemacht und Online-Kosten dafür ausgegeben, den Beitrag 851 jedenfalls zu überfliegen. Genützt hat es mir nichts. Können Sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, was wir daraus für die Baupraxis lernen? -
Hersteller fragen
Die sollen den Kopf dafür hinhalten. Ich kenne Foamglas nur vom Dach, und da wird es in Bitumen eingeschwemmt. -
Dankeschön,
an alle, die mitdiskutiert haben - besonders an MB. Ich denke, jetzt habe ich erst mal Grundlagen für die weitere Planung. Damit will ich dann noch einen Ortstermin durchführen, und dann müssen wir entscheiden, wie es weitergeht. -
Nachtrag
Verehrte Diskutanten,
zum Thema "Dämmen Dämmstoffe? ", bzw. "Welche Dämmstoffe dämmen? " haben wir ein kleines Praxisexperiment veranstaltet. Demnach darf man keine allzu großen Erwartungen in PS und Mineralwolle u. dgl. setzen. Der Bericht vom Experiment ist unter dem u.a. Link zu finden. Viel Spaß beim Grübeln! -
und danach am besten gleich Forum wechseln ...
und danach am besten gleich Forum wechseln zu laufenden Diskussionen: -
Und dann zurück zur Praxis
Wie sicher jeder denkende Mensch, der in diesem Forum mitliest (falls es den denn noch gibt), nachvollziehen kann, habe ich nach einem kurzen Blick in die Diskussion der (und über die) Bauphysik-Dilettanten beschlossen, mich wieder den Fragen der Praxis zuzuwenden. Das heißt in meinem Fall, nach einer Teilsanierung der Gründung des Gebäudes (inzwischen abgeschlossen) folgt Anfang nächsten Jahres die Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, und dann geht es an die (immer noch) spannende Frage der Innendämmung. Herrn Fischers Experimente und das gesammelte Halb- und Viertelwissen (Halbwissen, Viertelwissen) seines Anhangs (Bossert, Maier, Müller, Schulze usw.) werden mir dabei jedenfalls nicht weiterhelfen können, so viel ist mir inzwischen klar geworden.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, Feuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … kontrollierten Wohnungslüftung sparen Sie Energie ( Wärmerückgewinnung ) und die entstehende Feuchte ( 4 Pers. = 10 L. Wasser / Tg. )wird mit der …
- … Luftaustausch und Feuchte gleichmässig, kein Schimmel mehr! …
- … so dass sich durch die Mischung ein sehr angenehmer und gesunderhaltender Feuchtewert einstellt, der aber das Milben-wachstum zurückdrängt. Kondensation und damit Schimmelbildung …
- … Effizienz. Im Mittelpunkt steht der Primärenergieverbrauch für Beheizung/ Warmwasser der Wohngebäude und für erforderliche Heiz- und Anlagentechnik (u.a. Lüftungsanlagen) sowie die luftdichte …
- … Ausführung der Gebäudehülle. Niedrigenergiebauweise ist Baustandard und damit wird der zulässige Jahresheizwärmebedarf im Vergleich zur WSVO 95 noch einmal um ca. 30% unterschritten. Bedingt durch diese Entwicklung sind heutige Häuser im Neubau warm angezogen . Die notwendigen Luftwechsel zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Wohlbefinden der Bewohner müssen aber ebenso sichergestellt werden. Die freie Fensterlüftung, als einfachste Form der Frischluftzufuhr, birgt insbesondere in der Heizperiode enormes Wärmeverlustpotential. Lüftungswärmeverluste nehmen mittlerweile einen Anteil von über 50% an den Gesamtwärmeverlusten des Hauses ein. Kostbare Heizwärme und Energie einzusparen liegt in aller Interesse. Dies schont den Geldbeutel und unsere Umwelt. Deshalb ist eine Kontrollierte Wohnraumlüftung nicht nur sinnvoll, sondern Forderung unseres aktuellen und zukünftigen Baustandards. Die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bietet zusätzliche Nutzen. Wärme aus der Abluft wird gefiltert der kühleren Zuluft, z.B. über einen Kreuzstromwärmetauscher, übertragen. Dies mindert zum einen die Heizkosten der Wohnung bzw. des Wohngebäudes und erhöht gleichzeitig, durch permanenten Luftaustausch, den Wohnkomfort. …
- … Die Energieeinsparverordnung legt maximale Werte für den Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden fest. Dabei wird erstmalig als ganzheitliche Betrachtung der eingebauten Anlagentechnik (Heizung, …
- … gleiche Stellenwert zugebilligt wie dem baulichen Wärmeschutz (Isolierung, Fenster, Dichtigkeit des Gebäudes). Dies hat zur Folge, dass der Bauherr und der Architekt …
- … mehr Freiheiten in der Planung der Wohngebäude haben. Die hygienischen Vorteile einer kontrollierten Wohnungslüftung werden auch im Nachweisverfahren und im Energiebedarfsausweis als zusätzliche Qualität sichtbar. Ein Wohngebäude mit kontrollierter Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung hat hygienische Vorteile und im …
- … besser der Wärmeschutz wird, umso wichtiger wird die kontrollierte Wohnungslüftung, um Feuchte und Luftschadstoffe so energiesparend wie möglich abzuführen. …
- … ist eine Energieeinsparung sinnvoll. Der Energieverbrauch für die Raumheizung von Wohngebäuden macht ca. 25 % des Gesamtenergieverbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland aus... …
- … u.a. Quelle: Infoschrift des Fachinstitutes Gebäude-Klima e.V. Luft als Lebensmittel DM-Werte wurden in Euro umgerechnet …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit Streifenfundament eine Drainage notwendig? …
- … Unterschiedliche Verfahren zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk werden beschrieben. Auch ungeeignete Verfahren werden in diesem Zusammenhang genannt. …
- … stehen vor der Frage, welches Verfahren ge-gen aufsteigende Feuchtigkeit für welches Gebäude geeignet ist. Dabei gibt es grundsätzliche Un-terschiede: z.B. mechanische Trennungen; Injektionen …
- … Diese Techniken können, sofern für das jeweilige Gebäude geeignet, selbstverständlich auch mit-einander kombiniert werden. Stets aber muß von Fall …
- … Eine vorherige fachkompetente Prüfung, sowohl des Feuchte- als auch des Salzgehaltes ist genauso wichtig wie die Verträglichkeit der …
- … Entfeuchtungsputze entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz. …
- … chen Belastungen eines alten Gebäudes, durch Setzungen oder Nutzungsänderungen, unterschiedli-che Lasten eintreten können. Diese weichen …
- … Las-ten ab. Nach einem Sägeschnitt kommt es an einigen Stellen im Gebäude zu einer Entlastung und an anderen Stellen zu einer Mehrbelastung. …
- … diese neue Belas-tung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch noch zu einem späteren Zeitpunkt auftreten. …
- … 3.3 Risse im Gebäude …
- … Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass selbst kleine Risse an einem Gebäude sicherlich einen Schaden (Mangel) darstellen, jedoch wird dieser oft überbewertet. …
- … Wenn Spundwände in unmittelbarer Umgebung des Gebäudes eingerammt werden, treten allerdings wesentlich mehr Erschütterungen und Rißgefahren auf. …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen …
- … einfach zu ermitteln. Selbst wenn zwei Häuser in der gleichen Straße Feuchteschäden aufweisen, muss es nicht die gleiche Ursache haben. …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme-Sonden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Entscheidungshilfe Wärmepumpe
- … Die sicheren Erfahrungswerte für einen horizontalen Erdkollektor geben für normalen Erdboden (feuchter Lehmboden/-gemische) eine Entzugsleistung von 20 bis 25 Watt/m² an. …
- … ist es preislich nur noch ein Wimpernschlag zu Erdsondenbohrungen. Für Ihr Gebäude würde die Wärmequelle Erdsonde fix und fertig inkl. eingefüllter Sole und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe - macht es Sinn?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raum-Luftfeuchtigkeit liegt 21 % durch Nibe Fighter 600 P
- … gebaut (Holzstaänder oder massiv)? Welche Temperatur liegt dem Messwert der Luftfeuchte zu Grunde? Sind tatsächlich alle Räume betroffen? …
- … Abluft-Wärmepumpe. Wenn die Raumluftfeuchte auf 21 % sinkt, hat die Nibe eigentlich mit dieser Tatsache gar nichts zu tun, denn die Nibe bläst die abgekühlte und damit trockenere Luft (absolut betrachtet) nach draußen. Die Zuluft, die von Außen komm sollte aber eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen oder die Luftfeuchtigkeit muss in der Zuluft erhöht werden. Wie funktioniert bei Ihnen die Zuluft? …
- … Wenn ausreichend gelüftet wird, ist die Luftfeuchte gleich - unabhängig davon ob Fensterlüftung oder kontrollierte Lüftung. Wird …
- … °C erwärmt sinkt die rLF auf 8 %, bei 100 % Außenfeuchte auf 14 %. Durch die Feuchteabgabe in der Wohnung (Atmung, …
- … Steigern der Luftfeuchtigkeit gibt es 2 Wege: Belüftungsrate reduzieren (die abgegebene Feuchte verteilt sich dann auf ein geringeres Luftvolumen), was ich im Allgemeinen …
- … ungewöhnlich hohen Luftwechsel) oder mehr Feuchtigkeitsabgabe. Das wäre z.B. Zuluft befeuchten (ist aber problematisch wegen ausreichender Wartung - bei nicht ausreichender Wartung …
- … Wärmetauscher o.ä. dazwischen. Die zusätzliche Außenluftansaugung ist meines Wissens optional für Gebäude, bei denen die Abluftmenge nicht ausreicht. Diese wird aber ausschließlich der …
- … Feuchtefreisetzung …
- … Bei einem angenommen Luftwechsel von 0,6/h und einem Volumen von 300 m³, wäre der Volumenstrom 180 m³/h. Hätte die Fortluft ca. 60 % rLF, so würden etwa 1,8 l Wasser/h ins Freie geblasen (Sättigungsfeuchte bei 21 °C ca. 18,3 g Wasser/m³). Da die …
- … der Heizperiode sollte für zusätzliche Luftbefeuchtung gesorgt werden um eine Luftfeuchte von 50-60 % zu erhalten. …
- … Luftbefeuchter (Verdampfer) bestellt. Mal sehn wie die mir das Problem lösen. …
- … 2. In der Heizperiode sollte für zusätzliche Luftbefeuchtung gesorgt werden um eine Luftfeuchte von 50-60 % zu erhalten. …
- … drei Luftbefeuchter (Verdampfer) bestellt. Mal sehn wie die mir das Problem lösen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frust über Pelletheizung
- … Das ist schon *extrem* wenig und auch mich würde nun Ihr Gebäude interessieren (Größe, Aufbau und was der Statiker so in den EnEV …
- … lüften. Ist das passiert? Ein Hygrometer hilft beim Abschätzen der Baufeuchte ungemein. Die Baufeuchte resultiert aus dem chemischen Abbinden der Baustoffe, …
- … nicht unbedingt aus Regen, der auf das Gebäude fällt. Also sind auch Gebäude, die in diesem knochentrockenen Sommer gebaut wurden, noch feucht. …
- … Es sei denn, die Pellets werden im Bereitschaftsbunker feucht (Baufeuchte?) und quellen ... dann müsste sich das ja mit der …
- … kWh/a. Summe der Hüllflächen 453 m² und 678 Kubikmeter beheiztes Gebäude. Unser Haus hat eine Wohnfläche von 160 m² auf zwei Etagen …
- … durchtrocknen kann's etwas dauern. Bei mir herrschen gerade 47 % Luftfeuchte bei 21 °C Innentemperatur. Geht aber im Winter bis auf 40 …
- … - Zu den Pellets: Dass sie wegen Feuchte klemmen, erscheint mir unwahrscheinlich. Wenn sie dagegen zu lang sind, kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wandstärke Pelletraum
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Lüftung OHNE Wärmerückgewinnung
- … Wie steht es z.B. mit der Luftfeuchte? Fällt diese im EWT aus oder leite ich kühle aber letztlich …
- … feuchte Luft ins Gebäude? …
- … Feuchtigkeit fällt im Erdwärmetauscher nur aus, wenn die relative Luftfeuchte im EWT 100 % überschreitet. Dies geschieht nur an warmen Tagen. Dann …
- … ist allerdings tatsächlich eine Verringerung der Luftfeuchte im Haus feststellbar. Im Winter sinkt die relative Luftfeuchte im EWT (da die Luft erwärmt wird), im Haus sinkt …
- … nun, dass sich die Luft im EWT zwar abkühlt, die enthaltene Feuchte aber konstant bleibt. Dadurch würde der vom Menschen empfundene Abkühlungseffekt stark …
- … herabgesetzt (feuchte Luft fühlt sich wärmer an). …
- … Kann man die Luft ohne Energieeinsatz entfeuchten? …
- … einen EWT angesogen werden soll, brauchen Sie eine extreme Luftdichtigkeit der Gebäudehülle (n50 sicherlich < 0,3), ansonsten zieht es die Luft überall …
- … Die absolute Luftfeuchte kann durch einen EWT gesenkt werden. Dies ist die einzig mögliche …
- … Das die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle zusätzlich spielt am Beispiel Föhn: Feuchte, ca. 20 °C warme Luft aus Italien strömt über die Alpen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Feuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäude, Feuchte" oder verwandten Themen zu finden.